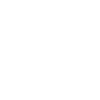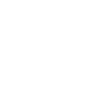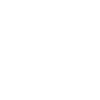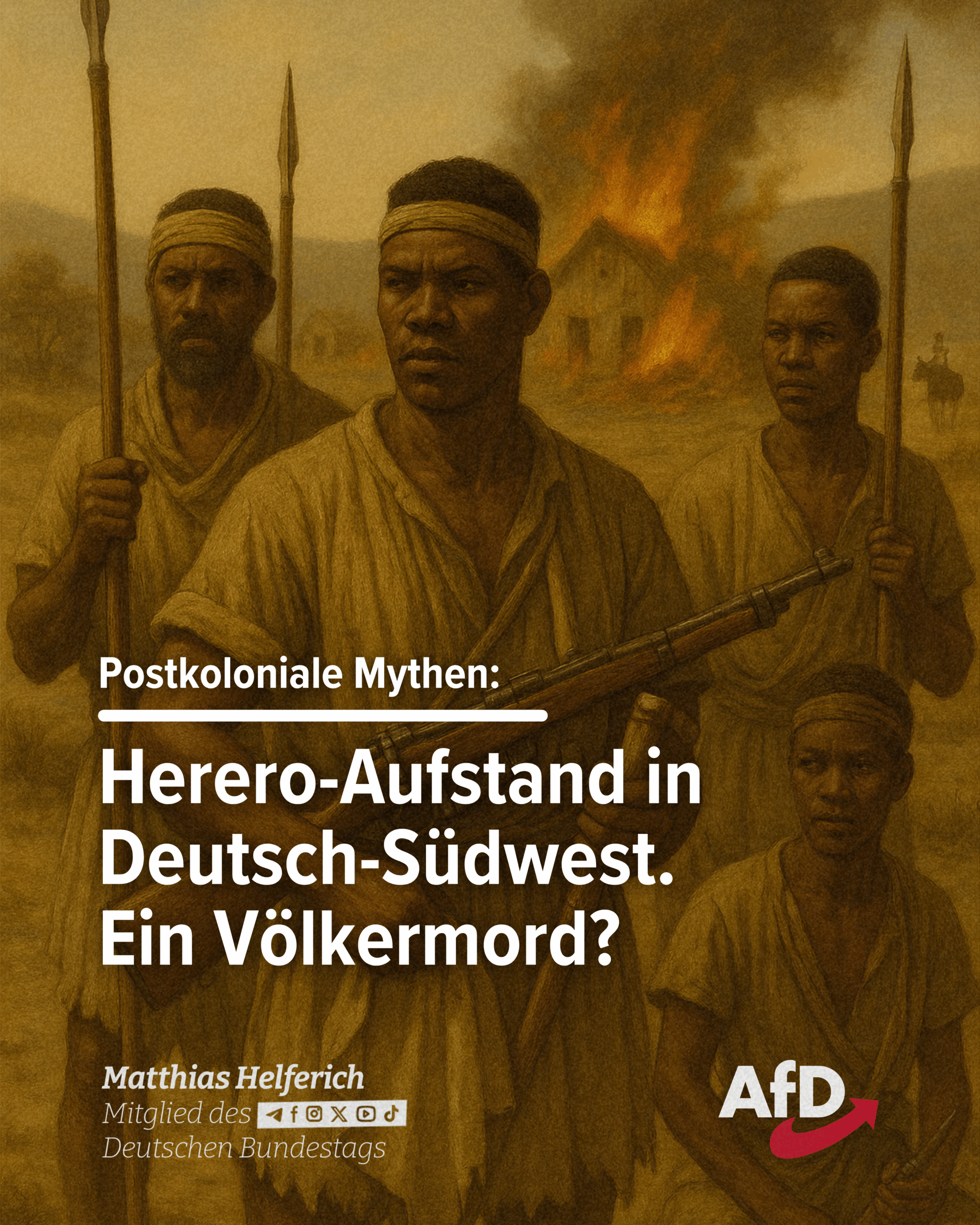Das heißeste Eisen in der deutschen Kolonialdebatte ist die Frage, ob Deutsch-Südwestafrika zwischen 1904 und 1908 Schauplatz eines Völkermordes wurde. In jener Zeit kam es im heutigen Namibia zum antikolonialen Aufstand zweier Volksgruppen – der Herero und Nama.
Beide Volksgruppen waren bereits vor der Kolonialzeit tief miteinander verfeindet und bekriegten sich gegenseitig. Mit der Ankunft der Deutschen wurden die blutigen Auseinandersetzungen vorübergehend beendet. Zuerst war das Verhältnis zwischen Deutschen und Einheimischen überwiegend positiv. Gemeinsam gelang ihnen 1897 die Bekämpfung einer Rinderpestepidemie, die dem Hirtenvolk der Herero unter anderen Umständen wohl schwer zugesetzt hätte.
Ein großer Fehler der Berliner Reichsregierung war jedoch die Ausweitung der deutschen Besiedlung, wogegen auch die örtliche Kolonialregierung protestierte. Das Verhältnis zwischen Deutschen und Herero verschlechterte sich rapide, weshalb die Herero im Herbst 1903 123 deutsche Siedler massakrierten.
Die Kolonialherren reagierten mit übertriebener Härte. Gegen den Rat höchster Stellen wurde Lothar von Trotha mit der Niederschlagung des Aufstandes betraut. Von Trotha galt als erbarmungsloser Hardliner mit zahlreichen charakterlichen Defiziten. Berüchtigt ist sein „Aufruf an das Volk der Herero“ von Oktober 1904, in dem er die Herero zum Verlassen der Kolonie aufforderte und die Erschießung aller Herero „mit und ohne Gewehr“ androhte. Viele Historiker sehen darin eine klare Vernichtungsabsicht, die auch durch die Vertreibung der Herero in die Omaheke-Wüste untermauert worden sei.
Der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages führt jedoch zahlreiche Quellen an, die keine eindeutige Vernichtungsabsicht in dem Vorgehen von Trothas sehen. Laut Gerd Sudholt sei nicht die Vernichtung das Ziel gewesen, sondern die „Brechung der militärischen Widerstandskraft der Herero“. Ferner spricht gegen die Genozid-These, dass der Befehl kaum zwei Monate in Kraft war, bis er auf Drängen Berlins wieder zurückgenommen wurde. Auch Susanne Kuss weist darauf hin, dass mit dem überaus harten Vorgehen keine Vernichtungsabsicht gegen die Herero und ebenfalls aufständischen Nama verfolgt wurde. Ein Großteil der Herero starb während des Aufstandes, doch wurde das Volk trotz der theoretischen Möglichkeit der deutschen Truppen dazu nicht ausgelöscht. Nach dem Aufstand normalisierten sich die Beziehungen etwas und der Anführer des Aufstandes, Samuel Maharero, wurde 1923 sogar nach deutscher Militärtradition von den Herero beigesetzt.
Schlussendlich bleibt festzuhalten: Die Niederschlagung des Aufstandes war einerseits unangemessen brutal und selbst im deutschen Mutterland höchst umstritten. Auch der deutsche Gouverneur in Deutsch Süd-West, Theodor Leutwein, kritisierte das Vorgehen von Trothas. Andererseits ist es legitim, der Genozidthese postkolonialer Historiker aus den genannten Gründen zu widersprechen. Zu keinem Zeitpunkt bestand ein systematischer Plan zwischen Kolonial- und Reichsregierung, die Volksgruppen der Herero und Nama in Gänze auszulöschen. Anders als im Falle des Völkermords in Ruanda 1994 fehlt somit ein wichtiger Baustein. Diesen hätte es aber bedurft, um die Schwelle vom brutalen Kolonialkrieg zum härteren und folgenreicheren Urteil des Genozids zu überschreiten.
Quellen:
Gilley, B. (2021). Verteidigung des deutschen Kolonialismus. Lüdinghausen: Manuscript Verlagsbuchhandlung Thomas Hoof
Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages. (2021). Einzelfragen zum Oberbefehlshaber der kaiserlichen „Schutztruppe“ in „Deutsch-Südwestafrika“ Lothar von Trotha,
Kuß, S. (2017). German Colonial Wars and the Context of Military Violence. Cambridge: Harvard University Press, S. 74–77